Klein Zaches und das Märchen
E. T. A. Hoffmann bezeichnet Klein Zaches, genannt Zinnober im Untertitel als Märchen - es ist ihm also wichtig gewesen, dass man sein Werk bereits vor dem Aufschlagen der ersten Seite als Märchen betrachtet und auch so liest. Es handelt sich aber um ein sogenanntes Kunstmärchen, also ein von ihm selbst erfundenes und damit eben kein vom Volk überliefertes. Hoffmann greift die Märchenform auf, verändert sie aber an entscheidenden Stellen. Worin die Ähnlichkeiten zwischen Hoffmanns und der völkischen Version von Märchen bestehen und worin die Unterschiede, soll anhand von drei Punkten erläutert werden: Gut und Böse, das Wunderbare und die Intention; auf die Form wurde im Kapitel Struktur bereits eingegangen.
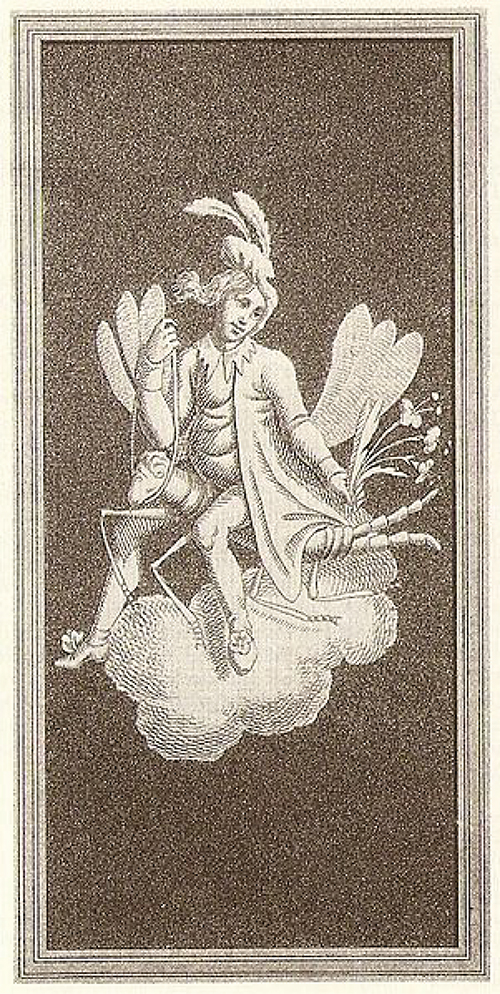 Abb. 1: Prosper fliegt auf seiner Libelle, Kupferstich von Carl Friedrich Thiele (1819/1820).
Dem innigen Gefühl Balthasars steht eine Gesellschaft gegenüber, die alles anhand seiner Nützlichkeit bewertet (wobei hier die Begeisterung, die man Balthasars Gedicht entgegenbringt, zumindest für eine kunstverständige Gesellschaft spricht). Das traditionelle Märchenelement der Hilfe des Helden durch seine Freunde und Personen, die er erst kennenlernt, findet sich auch hier. Ein Sieg Balthasars über Zaches wäre ohne die Hilfe Pulchers (der entdeckte, dass Zaches jeden neuten Morgen von einer Fee gekämmt wird), Prosper Alpanus‘ (der Balthasar den Weg zeigt und die Mittel gibt, um den Zauber zu brechen) und Fabian (der ihn emotional unterstützt) undenkbar.
Dieses Bild vom guten Ich und der bösen Welt lässt sich aber nicht aufrechterhalten, wenn man sich Klein Zaches genauer ansieht. Balthasar, der Vertreter der Romantik, ist auch ein Opfer von E. T. A. Hoffmanns Humor. Sein überspitzt träumerisches Verliebtsein wird von Fabian belächelt, Balthasar muss selbst zugeben, sich wie ein Narr zu verhalten. Seine Prinzipientreue wird dadurch abgeschwächt, dass er trotz seiner Abneigung gegenüber Terpins Methoden dessen Vorlesungen besucht, weil er Candida liebt. So ernst und düster, wie er sich zuerst vor Fabian präsentieren möchte (S. 28) ist er nicht, stattdessen ist er einfach nur sehr verliebt.
Diese Ironie stellt Balthasar zwar moralisch nicht infrage, betont aber den unernsten Charakter des Märchens - konsequenterweise bleibt auch das Böse vom Humor Hoffmanns nicht verschont. Ganz im Gegensatz zu den oft grausamen und fürchterlichen Bösewichten in Märchen (ein Wolf, eine kinderfressende Hexe o. ä.) ist Zaches grotesk, also bis zur Absurdität verunstaltet, kaum ernst zu nehmen, allen Gesetzen der Schönheit widersprechend. Ein Wurzelmann, der sich kaum auf den eigenen Beinen halten kann und sich so ungehobelt und ungezogen benimmt, wie es nur geht, erzeugt eher Gelächter als Furcht. Vor allem, dass Zaches als missgestalteter und untalentierter Mann zum allseits geliebten und hochgeehrten Minister Zinnober wird, der am Hofe (dem Ort der Bildung, des Anscheins, der guten Manieren) nicht auffällt, ist nicht gruselig, sondern widerspricht dermaßen aller Logik, dass einem nur das Lächeln übrigbleibt. Zaches ist kein übermächtiger, grausamer Bösewicht, sondern ein schwacher, der nur durch den Zauber einer mitleidigen guten Fee bestehen kann. Einzelne Szenen wie der Selbstmordversuch Pulchers oder Zaches‘ Tod im Nachttopf sind zwar drastisch und können erschrecken, aber werden durch direkt danach wieder einsetzenden Humor abgeschwächt - zudem ist Zaches‘ Tod an sich schon komisch, da Hoffmann hier ein Wortspiel verarbeitet: Zaches sei im Humor ertrunken (Humor heißt im ursprünglichen Sinne Körperflüssigkeit). Das Böse ist also nicht ernstzunehmen und verliert dadurch seinen Schrecken.
Das Böse wird im Weiteren dadurch gemildert, dass Zaches anfangs selbst ein Opfer ist. Als missgestaltetem Kind einer armen Bäuerin hat er keine rosigen Zukunftsaussichten. Das bereits erwähnte Mitleid einer guten Fee hilft ihm, es ist also kein prinzipiell böser Zauber und soll Zaches sogar erziehen, wie Rosabelverde später bezeugt (S. 106). Die Welt, gegen die Balthasar bestehen muss, ist überdies Opfer durch Zaches‘ Zauber - und ebenso überspitzt und nicht ernstzunehmen, wie er selbst. Fürst Barsanuph und seine Beamten sind keine Menschen, die es grundsätzlich böse meinen, es sind lediglich in einer höfischen, lebensfernen Scheinwelt lebende, sich selbst unglaublich wichtig nehmende Mitglieder einer Elite, die im Wesentlichen aus Nichtskönnern besteht (Terpins Naturwissenschaft ist sehr fragwürdig; der Außenminister behauptet, seine Reden selbst zu schreiben, obwohl das einer seiner Angestellten tut usw.). Das ist ein typisches Komödienelement: Menschen nehmen sich trotz ihrer offensichtlichen Schwächen so ernst, dass man darüber lachen muss. Das Böse ist in Klein Zaches nicht das verhängnisvolle aus den Märchen, sondern lächerlich.
Während im Märchen der Held und das Gute im Vordergrund stehen, stehen hier Gut und Böse fast gleichberechtigt nebeneinander: Im Märchen wird lediglich beschrieben, welche Auswirkungen das Böse auf den Helden hat, unabhängig vom Helden ist es nicht zu denken, denn alles dreht sich um den Helden selbst. In Klein Zaches jedoch wird „das Böse“ auch unabhängig von seiner Auswirkung auf den Helden beschrieben, so ist die Information, dass Zaches den Orden des grüngefleckten Tigers erhält und ein Expertenteam eine Woche darüber grübelt, vollkommen unwichtig für Balthasar. Solche Ausschmückungen dienen nicht dem Märchencharakter, sondern der humoristischen Seite des Werkes. Dass neben dem Sieg des Guten auch der Aufstieg von Zaches geschildert wird, ist auch als Abkehr von der traditionellen Märchenform zu bewerten.
Doch die Trennlinie von Held und ihm gegenüberstehender Gesellschaft wird auch durch Balthasar selbst überschritten: Sein Freund Fabian ist ganz und gar kein Romantiker und macht sich über Balthasar lustig; er besucht die Vorlesungen Terpins, dem er am Ende sogar ein Geschenk macht; Balthasar siegt nicht über die Gesellschaft, sondern über Zaches und duldet es, dass dieser auch nach seinem Tod noch als Zinnober gefeiert wird, anstatt der Gesellschaft vorzuhalten, wie einfach sie sich hat täuschen lassen. Balthasar kommt mit der Gesellschaft überein, ohne sie wirklich zu verändern, er wird in sie eingegliedert (auch wenn ihm sein Wohnort einige Freiheiten lässt). Die größtmögliche Vermischung von Gut und Böse geschieht jedoch durch Rosabelverde: Die gute Fee richtet mit einem gut gemeinten Zauber einigen Schaden an und begünstigt das Entstehen einer Tyrannei. Letztlich dient die Überschreitung der Trennlinie zwischen Gut und Böse der humoristischen Seite des Märchens.
Abb. 1: Prosper fliegt auf seiner Libelle, Kupferstich von Carl Friedrich Thiele (1819/1820).
Dem innigen Gefühl Balthasars steht eine Gesellschaft gegenüber, die alles anhand seiner Nützlichkeit bewertet (wobei hier die Begeisterung, die man Balthasars Gedicht entgegenbringt, zumindest für eine kunstverständige Gesellschaft spricht). Das traditionelle Märchenelement der Hilfe des Helden durch seine Freunde und Personen, die er erst kennenlernt, findet sich auch hier. Ein Sieg Balthasars über Zaches wäre ohne die Hilfe Pulchers (der entdeckte, dass Zaches jeden neuten Morgen von einer Fee gekämmt wird), Prosper Alpanus‘ (der Balthasar den Weg zeigt und die Mittel gibt, um den Zauber zu brechen) und Fabian (der ihn emotional unterstützt) undenkbar.
Dieses Bild vom guten Ich und der bösen Welt lässt sich aber nicht aufrechterhalten, wenn man sich Klein Zaches genauer ansieht. Balthasar, der Vertreter der Romantik, ist auch ein Opfer von E. T. A. Hoffmanns Humor. Sein überspitzt träumerisches Verliebtsein wird von Fabian belächelt, Balthasar muss selbst zugeben, sich wie ein Narr zu verhalten. Seine Prinzipientreue wird dadurch abgeschwächt, dass er trotz seiner Abneigung gegenüber Terpins Methoden dessen Vorlesungen besucht, weil er Candida liebt. So ernst und düster, wie er sich zuerst vor Fabian präsentieren möchte (S. 28) ist er nicht, stattdessen ist er einfach nur sehr verliebt.
Diese Ironie stellt Balthasar zwar moralisch nicht infrage, betont aber den unernsten Charakter des Märchens - konsequenterweise bleibt auch das Böse vom Humor Hoffmanns nicht verschont. Ganz im Gegensatz zu den oft grausamen und fürchterlichen Bösewichten in Märchen (ein Wolf, eine kinderfressende Hexe o. ä.) ist Zaches grotesk, also bis zur Absurdität verunstaltet, kaum ernst zu nehmen, allen Gesetzen der Schönheit widersprechend. Ein Wurzelmann, der sich kaum auf den eigenen Beinen halten kann und sich so ungehobelt und ungezogen benimmt, wie es nur geht, erzeugt eher Gelächter als Furcht. Vor allem, dass Zaches als missgestalteter und untalentierter Mann zum allseits geliebten und hochgeehrten Minister Zinnober wird, der am Hofe (dem Ort der Bildung, des Anscheins, der guten Manieren) nicht auffällt, ist nicht gruselig, sondern widerspricht dermaßen aller Logik, dass einem nur das Lächeln übrigbleibt. Zaches ist kein übermächtiger, grausamer Bösewicht, sondern ein schwacher, der nur durch den Zauber einer mitleidigen guten Fee bestehen kann. Einzelne Szenen wie der Selbstmordversuch Pulchers oder Zaches‘ Tod im Nachttopf sind zwar drastisch und können erschrecken, aber werden durch direkt danach wieder einsetzenden Humor abgeschwächt - zudem ist Zaches‘ Tod an sich schon komisch, da Hoffmann hier ein Wortspiel verarbeitet: Zaches sei im Humor ertrunken (Humor heißt im ursprünglichen Sinne Körperflüssigkeit). Das Böse ist also nicht ernstzunehmen und verliert dadurch seinen Schrecken.
Das Böse wird im Weiteren dadurch gemildert, dass Zaches anfangs selbst ein Opfer ist. Als missgestaltetem Kind einer armen Bäuerin hat er keine rosigen Zukunftsaussichten. Das bereits erwähnte Mitleid einer guten Fee hilft ihm, es ist also kein prinzipiell böser Zauber und soll Zaches sogar erziehen, wie Rosabelverde später bezeugt (S. 106). Die Welt, gegen die Balthasar bestehen muss, ist überdies Opfer durch Zaches‘ Zauber - und ebenso überspitzt und nicht ernstzunehmen, wie er selbst. Fürst Barsanuph und seine Beamten sind keine Menschen, die es grundsätzlich böse meinen, es sind lediglich in einer höfischen, lebensfernen Scheinwelt lebende, sich selbst unglaublich wichtig nehmende Mitglieder einer Elite, die im Wesentlichen aus Nichtskönnern besteht (Terpins Naturwissenschaft ist sehr fragwürdig; der Außenminister behauptet, seine Reden selbst zu schreiben, obwohl das einer seiner Angestellten tut usw.). Das ist ein typisches Komödienelement: Menschen nehmen sich trotz ihrer offensichtlichen Schwächen so ernst, dass man darüber lachen muss. Das Böse ist in Klein Zaches nicht das verhängnisvolle aus den Märchen, sondern lächerlich.
Während im Märchen der Held und das Gute im Vordergrund stehen, stehen hier Gut und Böse fast gleichberechtigt nebeneinander: Im Märchen wird lediglich beschrieben, welche Auswirkungen das Böse auf den Helden hat, unabhängig vom Helden ist es nicht zu denken, denn alles dreht sich um den Helden selbst. In Klein Zaches jedoch wird „das Böse“ auch unabhängig von seiner Auswirkung auf den Helden beschrieben, so ist die Information, dass Zaches den Orden des grüngefleckten Tigers erhält und ein Expertenteam eine Woche darüber grübelt, vollkommen unwichtig für Balthasar. Solche Ausschmückungen dienen nicht dem Märchencharakter, sondern der humoristischen Seite des Werkes. Dass neben dem Sieg des Guten auch der Aufstieg von Zaches geschildert wird, ist auch als Abkehr von der traditionellen Märchenform zu bewerten.
Doch die Trennlinie von Held und ihm gegenüberstehender Gesellschaft wird auch durch Balthasar selbst überschritten: Sein Freund Fabian ist ganz und gar kein Romantiker und macht sich über Balthasar lustig; er besucht die Vorlesungen Terpins, dem er am Ende sogar ein Geschenk macht; Balthasar siegt nicht über die Gesellschaft, sondern über Zaches und duldet es, dass dieser auch nach seinem Tod noch als Zinnober gefeiert wird, anstatt der Gesellschaft vorzuhalten, wie einfach sie sich hat täuschen lassen. Balthasar kommt mit der Gesellschaft überein, ohne sie wirklich zu verändern, er wird in sie eingegliedert (auch wenn ihm sein Wohnort einige Freiheiten lässt). Die größtmögliche Vermischung von Gut und Böse geschieht jedoch durch Rosabelverde: Die gute Fee richtet mit einem gut gemeinten Zauber einigen Schaden an und begünstigt das Entstehen einer Tyrannei. Letztlich dient die Überschreitung der Trennlinie zwischen Gut und Böse der humoristischen Seite des Märchens.
Gut und Böse
Ein herausstechendes Merkmal von Märchen, ja vielleicht ihr bestimmendes Merkmal, ist die klare Trennung von Gut und Böse. Oberflächlich gesehen, stimmt das auch für Klein Zaches: Auf der einen Seite steht Balthasar, ein ehrlicher, aufrichtiger romantischer Idealtyp, auf der anderen Seite der korrupte Betrüger und Egoist Zaches. In diesem Konflikt kann man nur zu Balthasar halten, Zaches kann man allenfalls Mitleid, aber keine Sympathie entgegenbringen. Während Balthasar sich stets gut verhält (jedenfalls im Sinne der Romantik), vollbringt Zaches keine gute Tat, wenn man mal von der Erhebung seines Schwiegervaters zum Direktor für natürliche Angelegenheiten absieht, die zwar nicht die Wissenschaft voranbringt, aber Terpin ein schönes Leben ermöglicht. E. T. A. Hoffmann, einer der großen Köpfe der Romantik, macht überdeutlich, welche Seite im Recht ist. Typisch für Märchen ist zudem, dass das Gute sich seinen Sieg erkämpfen muss, es ist anfangs im Nachteil, der Held ist oft schwach, jung, arm oder krank und muss sich gegen das starke Böse behaupten, befindet sich am Ende aber selbst in einer starken Position. Dabei ist der Held meistens isoliert und hat nur wenige Helfer, das Böse aber zeigt sich häufig in der Form von bösen Königinnen oder Herrschern, also in Staatsoberhäuptern, somit ist die ganze Gesellschaft im Griff des Bösen. Daher kann man auch vom Gegensatz zwischen dem Ich (Held) und der Welt („das Böse“) sprechen. Auch das lässt sich auf Klein Zaches übertragen: Balthasar ist bereits anfangs teilweise isoliert, denn er steht als Romantiker einer Gesellschaft gegenüber, der die Aufklärung verordnet wurde. Er und die Gesellschaft sind also wesensverschieden. Terpin ist der beliebteste Professor, seine Experimente und Versuche, die Natur durch einfache, rationale Regeln zu erklären, finden Beachtung. Balthasar jedoch lehnt dieses Vorgehen nicht nur ab, es widert ihn an, da das Wesen der Natur für ihn unerklärlich, mystisch und geheimnisvoll ist, die Naturwissenschaft der Aufklärung hält er für eine Entweihung der Natur. Er steht mit seiner Meinung weitgehend alleine da, ist zwar kein Ausgestoßener (schließlich genießt er bei Terpin selbst einiges Ansehen, wo er doch zum Teezirkel eingeladen wird), aber ein Außenseiter. Er genießt es, alleine im Wald herumzuwandeln. Dieses Verhalten bezeichnet sogar sein Freund Fabian als unheimlich (vgl. S. 25).
Durch den Aufstieg Zaches‘ ändert sich jedoch Balthasars Stellung: Zaches wird zum neuen Liebling Terpins und des Fürsten, er stiehlt Balthasars geliebte Candida und erlässt nach der Prügel über Alpanus‘ Zauberspiegel einen Haftbefehl, sodass Balthasar offiziell zum Verbrecher erklärt wird und ins Dorf Hoch-Jakobsheim flüchten muss. Seine Lage entspricht der eines Märchenhelden: Verfolgt und nahezu machtlos gegenüber dem übermächtigen Bösen, angewiesen auf die Hilfe anderer. Er hält jedoch an seiner Sache fest und gibt nicht auf, er tritt somit für das Gute ein - denn seine Sache ist die Sache des Guten. Es mag zwar eher als egozentrische denn als moralische Tat angesehen werden, Zaches‘ Position zu zerstören und Candida zurückzugewinnen, doch lässt sich der Konflikt der beiden auch anders darstellen. Balthasar verkörpert nämlich das Natürliche, Ungekünstelte und Echte, er hält an seinen Ansichten fest und tritt für die Wahrheit ein. Zaches jedoch ist ein Betrüger, der sich die Eigenschaften und Taten anderer anrechnen lässt, ohne deswegen beschämt zu sein oder auch nur Skrupel zu haben. Er verkörpert das Falsche, Verlogene, Egoistische. Die von Zaches getäuschte Gesellschaft besteht aus Opportunisten (= Menschen, die sich immer auf die Seite des Siegers schlagen), korrupten und auf ihren sozialen Stand bedachten Menschen, denen ihr Schein extrem wichtig ist - die Episode mit der Verleihung des Ordens des grüngefleckten Tigers an Zaches zeigt beispielhaft, welch große Rolle der Anschein in der Gesellschaft des Fürstentums spielt.
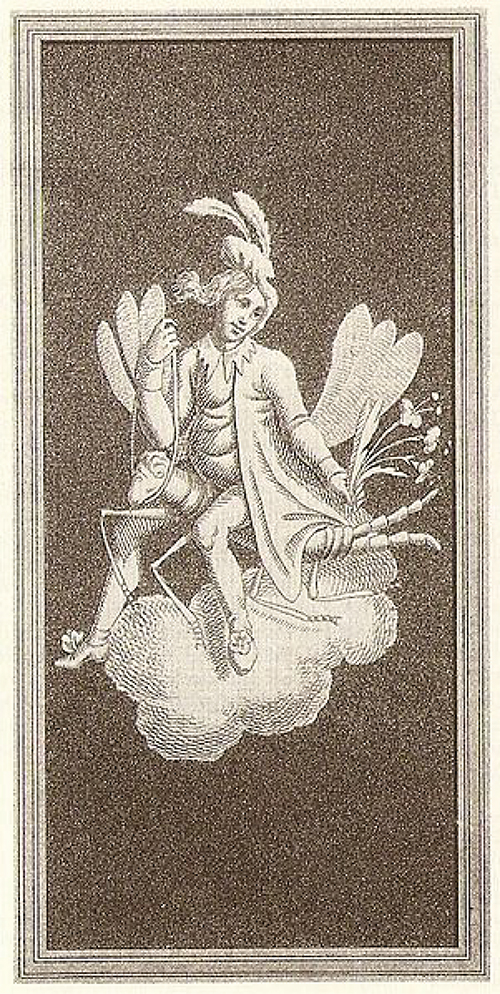 Abb. 1: Prosper fliegt auf seiner Libelle, Kupferstich von Carl Friedrich Thiele (1819/1820).
Abb. 1: Prosper fliegt auf seiner Libelle, Kupferstich von Carl Friedrich Thiele (1819/1820).
Das Wunderbare
Klein Zaches ist voll vom Zauber- und Wunderhaften des Märchens. Die Welt ist bevölkert vom Zauberern Prosper Alpanus und der Fee Rosabelverde, die aus dem sagenhaften Land Dschinnistan stammen. Hier werden die Einflüsse aus der Geschichtensammlung Tausendundeiner Nacht offenbar, die Hoffmann über französische Feenmärchen kennenlernte. Der Bruch eines bösen Zaubers (der hier gut gemeint war) durch den Helden ist ebenfalls typisch für Märchen; dabei erfährt Balthasar Hilfe durch den Zauberer Prosper Alpanus, ein Beispiel für den väterlichen, weisen Magier. In dieser Welt gibt es Einhörner, Gestaltwandler, zahlreiche kleine Zauber. Doch eben hier liegt auch der Unterschied zu dem selbstverständlichen Hinnehmen von Zauberei in Märchen, denn die Magie ist im offiziell aufklärerischen Fürstentum strikt verboten und existiert eigentlich auch gar nicht (sofern man den Beamten glaubt). Einerseits findet das Märchenhafte Einzug im Alltag, so durch Rosabelverdes Zauber, dem die ganze Gesellschaft zum Opfer fällt und den doch kaum jemand bemerkt. Andererseits wird die Märchenwelt aber auch vermenschlicht: Prosper Alpanus spricht von seiner Studienzeit in Dschinnistan, als er „Kollegia bei dem Professor Zoroaster, einem alten Knasterbart“ hörte (S. 78). Typisch menschliche Institutionen wie Universitäten gibt es also auch in einem Lande voller magischer Wesen. Und auch dort können sich junge Studenten langweilen. Hoffmann macht die Natur des Wunderhaften selbst zum Thema, sein Kunstmärchen, das voll von absurden Fantasieprodukten ist (man denke nur an das Zauberduell zwischen Alpanus und Rosabelverde), bezieht sich ganz märchenuntypisch auch auf die damalige Gesellschaft, ist also nicht der Realität gänzlich entrückt, sondern zudem eine satirische Zeitkritik.Die Intention
Von Märchen sagt man oft, dass sie eine bestimmte Intention oder ein Motto hätten, das sie dem Leser vermitteln wollen - einerseits stimmt das nicht für alle Volksmärchen, andererseits würde sich bei Klein Zaches die Frage stellen, ob eine tatsächliche ernste Intention überhaupt möglich ist. Aufgrund von Hoffmanns Humor, dem das Gute wie das Böse ausgesetzt ist, werden beide relativiert. Man kann keine Person rundum ernst nehmen. Die zahlreichen formalen und inhaltlichen Brüche, die durch die romantische Ironie entstehen (s. u.), lassen keinen deutlichen moralischen Fingerzeig zu. Hoffmann möchte niemanden belehren, am besten nimmt man den Erzähler am Ende des letzten Kapitels beim Wort und nutzt das Märchen zur Unterhaltung, nicht zur moralischen Erziehung. Bildnachweise [nach oben]
Public Domain.