Vorschlag D
Materialgestütztes Schreiben eines argumentierenden Textes (Kommentar)
Thema: Teilhabe an der demokratischen Gesellschaft Aufgabenstellung:- An deiner Schule findet ein fächerübergreifendes Projekt zum Thema „Teilhabe an der demokratischen Gesellschaft“ statt. Dein Deutschkurs wird um Beiträge zum Thema der Teilhabe an der Kommunikation in politisch-gesellschaftlichen Zusammenhängen gebeten. Die Beiträge sollen auf der Schulhomepage veröffentlicht werden.
- Verfasse deshalb einen Kommentar zu der Frage, ob und inwiefern die Verwendung Leichter Sprache eine umfassende Teilhabe an der Kommunikation im öffentlichen Raum ermöglicht.
- Nutze dazu die folgenden Materialien 1 bis 6 und beziehe unterrichtliches Wissen und eigene Erfahrungen ein.
- Formuliere eine geeignete Überschrift.
- Verweise auf die Materialien erfolgen unter Angabe des Namens der Autorin oder des Autors und ggf. des Titels.
- Dein Kommentar sollte etwa 800 Wörter umfassen.
(100 BE)
1
Leichte Sprache
2
[...] Leichte Sprache rückt in Deutschland zunehmend ins öffentliche Bewusstsein. Leichte Sprache
3
im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) hat das Ziel, Menschen, die schriftliche
4
sowie mündliche Schwierigkeiten haben, abstrakte Dinge zu verstehen, die Teilhabe an Gesellschaft
5
und Politik zu ermöglichen. Sie folgt bestimmten Regeln, die unter maßgeblicher Mitwirkung des Ver-
6
eins Mensch zuerst entwickelt wurden, und zeichnet sich unter anderem durch kurze Hauptsätze und
7
den weitgehenden Verzicht auf Nebensätze und die Verwendung von bekannten Wörtern aus. Schwie-
8
rige Worte werden erklärt. Das Schriftbild ist klar, ohne Schnörkel (Serifen) und ausreichend groß.
9
Nach jedem Satzzeichen sowie bei sinnvollen Satzabschnitten folgt ein Absatz. Die Optik von Bild
10
und Schrift muss übersichtlich sein. Farben sind eher sparsam einzusetzen. Einfache Illustrationen
11
werden bei der Leichten Sprache Fotos vorgezogen, auf denen zu viele Details zu sehen sind.
12
Einfache Sprache
13
Anders als bei der Leichten Sprache gibt es für die Einfache Sprache kein Regelwerk. Sie ist durch ei-
14
nen komplexeren Sprachstil gekennzeichnet als die Leichte Sprache. Die Sätze sind länger, Neben-
15
sätze sind zulässig und sämtliche im Alltag gebräuchlichen Begriffe werden als bekannt vorausgesetzt.
16
Fremdworte sollten allerdings auch hier nach Möglichkeit vermieden werden, ansonsten sind sie zu
17
erklären. Nach Satzzeichen und Satzabschnitten muss nicht zwingend ein Absatz folgen, solange der
18
Text überschaubar bleibt. Auch das optische Erscheinungsbild von Schrift und Bild ist weniger streng
19
geregelt. Texte in Einfacher Sprache sind für viele Menschen hilfreich, etwa für Menschen mit Lese-
20
und Rechtschreibschwäche, hörbehinderte Menschen mit geringerer Lautsprachkompetenz, Menschen
21
mit geringen Deutschkenntnissen oder auch Personen, die in Berlin Urlaub machen. [...]
Aus: Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung: Vielfalt zum Ausdruck bringen! Ein Leitfaden für Mitarbeitende der Berliner Verwaltung. Abschnitte 2.4.1. Leichte Sprache und 2.4.2. Einfache Sprache, 2020., letzter Zugriff am 14.12.2022. Material 2 Für wen ist Leichte Sprache? (2022) Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e. V.
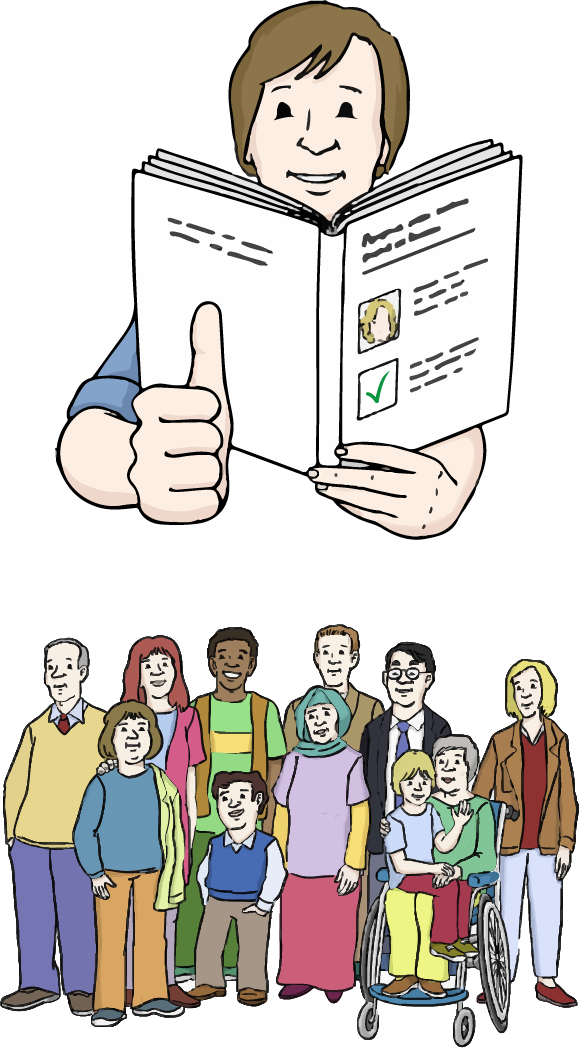
Menschen mit geistiger Behinderung
haben Leichte Sprache gefordert.
Darum ist Leichte Sprache
besonders für diese Menschen.
Leichte Sprache hilft auch Menschen,
die Probleme beim Lernen haben.
Leichte Sprache ist auch gut für viele andere Menschen. Zum Beispiel:Menschen mit Problemen beim Lesen und Schreiben.
Menschen, die gerade Deutsch lernen.
Alte Menschen.
Menschen, die Gebarden-Sprache brauchen.
Jugendliche.
haben Leichte Sprache gefordert.
Darum ist Leichte Sprache
besonders für diese Menschen.
Leichte Sprache hilft auch Menschen,
die Probleme beim Lernen haben.
Leichte Sprache ist auch gut für viele andere Menschen. Zum Beispiel:
Aus: Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen e. V. (2022): Für wen ist Leichte Sprache?, letzter Zugriff am 14.12.2022. Material 3 7 Dinge, die Sie über Leichte Sprache wissen sollten (2017) Nicola Pridik
1
1. Leichte Sprache ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe
2
[...] Große Teile der Bevölkerung sind nicht in der Lage, standardsprachliche Texte zu lesen und zu
3
verstehen. So gibt es in Deutschland allein rund 7,5 Mio. funktionale Analphabeten (vgl. LEO-Studie
4
2011). Hinzu kommen Menschen mit geistiger Behinderung, Menschen mit Lernschwierigkeiten (z. B.
5
aufgrund einer Legasthenie), an Demenz Erkrankte, Menschen mit Aphasien (Sprachstörungen), prä-
6
lingual Gehörlose und Personen mit geringen Deutschkenntnissen. Viele dieser Menschen müssen
7
dauerhaft mit ihrer Leseeinschränkung leben. Das gilt z. B. für Menschen mit geistiger Behinderung
8
und Menschen mit Demenz oder Aphasien. Andere sind potenziell in der Lage, durch entsprechendes
9
Training und/oder Förderangebote das Lesen standardsprachlicher Texte zu lernen. Selbst wenn ein
10
Lernerfolg möglich ist, vergeht jedoch regelmäßig viel Zeit, bis die Betroffenen ihr Ziel erreichen.
11
Alle genannten Personengruppen haben vorübergehend oder sogar dauerhaft keine Chance,
12
selbstbestimmt Informationen über Texte aufzunehmen. Sie sind deshalb aus der Gesellschaft aus-
13
geschlossen, denn in vielen Bereichen des Lebens sind wir auf schriftliche Informationen und die Be-
14
herrschung der Schriftsprache angewiesen. [...] Leichte Sprache hilft, die ausgrenzende Sprach-
15
barriere zu überwinden. Denjenigen, die ihr Sprachniveau verbessern können, baut sie darüber hin-
16
aus eine Brücke zur Standardsprache. [...]
17
2. Es geht nicht um „schöne“ Sprache
18
[...] Wer Texte in Standardsprache lesen und verstehen kann, empfindet Leichte-Sprache-Texte
19
zwangsläufig als befremdlich, weil die sprachlichen Möglichkeiten hier erheblich eingeschränkt sind.
20
Das zeigen bereits folgende Regeln auf Satzebene:
21
• Nur Hauptsätze sind erlaubt, keine Nebensätze.
22
• Es gibt keinen Genitiv.
23
• Es gibt kein Imperfekt und kein Futur.
24
• Es gibt keinen Konjunktiv.
25
• Es gibt kein Passiv.
26
Der Punkt ist: Es hat Gründe, warum diese Regeln existieren. Wer selbst nicht betroffen ist, kann es
27
sich zwar nur schwer vorstellen, aber es gibt Menschen, die können tatsächlich nur eine Information
28
pro Satz aufnehmen, einen Genitiv nicht verarbeiten oder haben Mühe, Formulierungen im Passiv zu
29
verstehen. Nicht jeder hat mit allen Facetten der Sprache Probleme, aber in der Leichten Sprache wer-
30
den alle berücksichtigt, um Informationen einer möglichst breiten, sehr heterogenen Leserschaft zu-
31
gänglich zu machen. Den Luxus „schöner“ Sprache kann sich im Kontext von Leichter Sprache
32
niemand leisten. Es geht vielmehr darum, ob Menschen Informationen aufnehmen und verste-
33
hen können oder nicht. [...]
34
3. Nicht jeder Text in Leichter Sprache ist ein guter Text:
35
Die ersten wissenschaftlich fundierten Regeln für Leichte Sprache wurden erst 2015 von der For-
36
schungsstelle Leichte Sprache (Universität Hildesheim) veröffentlicht. [...] Davor gab es nur sehr all-
37
gemein gehaltene Regeln, die zwar wichtige Vorgaben machten, die Leichte-Sprache-Übersetzer:in-
38
nen aber zugleich mit vielen Fragen zurückließen. [...] Diese Regeln wurden von der Forschungsstelle
39
konkretisiert und sprachwissenschaftlich unterfüttert, teilweise aber auch verändert.
40
Leichte Sprache ist also noch ein sehr junges Sprachkonzept, das erst seit kurzem professionelle
41
Formen annimmt. [...] Als Maßstab der Qualität und Verständlichkeit zählte [früher] allein die „Prü-
42
fung“ der Texte durch Vertreter der Zielgruppe(n). Heute existieren wissenschaftliche Regeln (deren
43
empirische Überprüfung noch aussteht) und Prüfgruppen nebeneinander. Mithilfe der wissenschaftli-
44
chen Regeln werden die Leichte-Sprache-Übersetzungen besser und die Prüfgruppen sind wichtig,
45
weil sie die Zielgruppen in die Entwicklung der Leichten Sprache einbeziehen.
46
4. Leichte Sprache ist kein falsches Deutsch
47
Zuweilen wundert man sich über sehr abenteuerliche Schreibweisen von Wörtern in Leichte-Sprache-
48
Texten [...]. Die Forschungsstelle sagt ganz klar: Alle Texte in Leichter Sprache müssen grammatika-
49
lisch und orthografisch richtig sein. Das ist schon deshalb wichtig, weil es fatal wäre, Menschen fal-
50
sches Deutsch zu vermitteln, denen die Leichte Sprache nur den Zugang zur Standardsprache ermögli-
51
chen soll. [...]
Anmerkungen zur Autorin:
Nicola Pridik (* 1970) ist Juristin und Inhaberin des Büros für klare Rechtskommunikation in Berlin. Aus: Pridik, Nicola (04.04.2017): 7 Dinge, die Sie über Leichte Sprache wissen sollten, letzter Zugriff am 23.07.2024. Material 4 Was macht Sätze leicht verständlich? (2018) Bettina M. Bock
1
[...] Was Sätze leicht oder schwer verständlich macht, ist nicht nur die Struktur - also die Syntax.
2
Ganz wesentlich ist, wie schon bei den Wörtern, die Bedeutungsebene - also die Semantik. Es geht
3
auf Satzebene also nicht nur um Phänomene wie Nebensätze und Satzkomplexität, sondern z. B. auch
4
um die Reihenfolge von Informationen (Der Mann betritt den Raum. – Den Raum betritt der Mann.)
5
oder die Vereindeutigung möglicher Lesarten eines Satzes (Sie probierte das Kleid im Schaufenster
6
an.). Einen Einfluss auf die Verständlichkeit hat auch, ob eine Formulierung in einem bestimmten Zu-
7
sammenhang besonders erwartbar oder der Leserschaft besonders vertraut ist. [...] Es ist selten mög-
8
lich, einzelne grammatische Phänomene isoliert als generell (zu) schwierig einzustufen. Viel hängt
9
vom sprachlichen Kontext ab, also den umgebenden Sätzen, ebenso viel vom außersprachlichen Kon-
10
text, also dem Verwendungszusammenhang. [...]
11
In [...] Regellisten [...] werden [...] auf Satzebene folgende Verstehenshürden immer wieder genannt:
12
Satzschachtelungen mit mehreren Nebensätzen
13
Satzklammer, z. B. bei unfesten Verbzusammensetzungen (z. B. Sie spricht den Kollegen aus der
14
Werkstatt an.)
15
ungewöhnliche Wortstellung
16
Nominalisierung (statt Die Forderung nach. z. B. Auflösung in einen Nebensatz wie: Sie
17
fordern, dass ...)
18
lange Sätze
19
Manches, wie Schachtelsätze und Nominalisierung, lässt sich relativ leicht vermeiden. Sie bereiten in
20
der Regel zweifellos unnötige Verstehensschwierigkeiten. Nebensätze sind unseren Tests zufolge al-
21
lerdings nicht grundsätzlich schwer verständlich. Die Frage der Satzlänge ist schwierig verallgemei-
22
nernd zu beantworten. Manchmal findet man in der Forschung die Angabe, dass ein Satz bei nicht-be-
23
einträchtigten Lesern nicht mehr als 7-8 Wörter haben solle. Solche Angaben orientieren sich an der
24
Spanne des Kurzzeitgedächtnisses, die bei den Adressatenkreisen „Leichter Sprache“ natürlich sehr
25
unterschiedlich sein kann.
26
In den Regelwerken wird außerdem empfohlen: Ein Gedanke pro Satz. In der Praxis wird das oftmals
27
so interpretiert, dass Sätze rein grafisch „zerlegt“, aber ansonsten unverändert gelassen werden (wie in
28
„Dafür wollen wir einen Plan machen. Und uns für Bildung stark machen.“). Solche elliptischen, also
29
unvollständigen Sätze werden dann in der Öffentlichkeit immer wieder kritisiert. Tatsächlich ist sehr
30
fraglich, inwiefern solch eine rein grafische „Satzzerlegung“ verständniserleichternd wirkt. Die Emp-
31
fehlung „ein Gedanke pro Satz“ sollte anders verstanden werden: Es geht vor allem um die Bedeu-
32
tungsebene, genauer: die Informationsdichte. Ein Satz wie
33
Ich habe ein gut lesbares Buch für Peter, in dem es um Vogelarten in den Alpen geht.
34
weist eine hohe Informationsdichte auf. Um den Satz inhaltlich zu „entzerren“, könnte man ihn in
35
mehrere Sätze auflösen und so den Inhalt völlig neu formulieren und darstellen:
36
Peter mag Vögel (= Kontext). Ich habe ein Buch für ihn. Im Buch geht es um Vogel-Arten in den Al-
37
pen. Das Buch ist gut lesbar. [...]
Anmerkung zur Autorin:
Bettina M. Bock (* 1982) ist als Sprachwissenschaftlerin an der Universität zu Köln tätig. Aus: Bock, Bettina M. (2018): „Leichte Sprache“ - Kein Regelwerk. Sprachwissenschaftliche Ergebnisse und Praxisempfehlungen aus dem LeiSA-Projekt, Leipzig: Qucosa, S. 86f., letzter Zugriff am 03.02.2023. Material 5 Leichte Sprache: Nachrichten im Kinderbuch-Stil (2017) Adrian Lobe
1
[...] Die Frage ist, ob man Rezipienten mit Leseschwächen erreicht, indem man Nachrichten künstlich
2
boulevardisiert und im vermeintlichen Kinderbuch-Stil erzählt. Gibt es eine Grenze für Komplexitäts-
3
reduktion? Ist dem Zielpublikum gedient, wenn man Inhalte über Gebühr simplifiziert? Wäre es nicht
4
besser, die Lesekompetenz zu stärken, statt komplexe Texte zu demontieren?
5
Die „Augsburger Allgemeine“ schreibt in Leichter Sprache über die Waldbrände in Portugal: „In dem
6
Land Portugal ist etwas Schlimmes passiert. Portugal ist in Europa. Es brennt in den Wäldern von Por-
7
tugal. Warum brennt es: In Portugal ist gerade Sommer. Überall ist [es] sehr heiß. In den Wäldern von
8
Portugal ist alles sehr trocken. Zum Beispiel die Bäume und Wiesen. Es gab ein Gewitter ohne Regen.
9
Der Blitz hat eingeschlagen. So fing es in den Wäldern an zu brennen.“
10
Dies ist ein Beispiel dafür, wie Leichte Sprache nicht funktionieren sollte: Kausalzusammenhänge
11
werden konstruiert, Erklärungen komplexer Phänomene verzerrt. Die Gleichung Sommer gleich Hitze
12
gleich Gewitter gleich Waldbrand ist stark verkürzt. Dass die Eukalyptus-Monokultur die Hauptursa-
13
che für die Brände ist, kommt in dem Artikel gar nicht vor. Dem Leser werden wesentliche Informati-
14
onen vorenthalten. Das kann nicht das Ziel Leichter Sprache sein.
15
Was an dem Vorhaben vor allem stört, ist, dass Sprache als ein Störfaktor desavouiert wird, der Men-
16
schen daran hindere, Nachrichten zu erfassen. Dabei ist doch Sprache wesentlich für die Qualität und
17
Güte eines Textes. Komplexe, vermeintlich „schwere“ Sprache erlaubt präzise Unterscheidungen, die
18
von einer simplifizierten Satzstruktur geschleift werden. Traut man der Leserschaft nichts mehr zu?
19
Der Internetkritiker Hossein Derakhshan schrieb in einem Gastbeitrag für die „Süddeutsche Zeitung“:
20
„Selbstverständlich wird Text nie aussterben, aber die Fähigkeit, über das Alphabet zu kommunizie-
21
ren, wird in vielen Gesellschaften langsam zum Privileg einer kleinen Elite. Das erinnert an das Mittel-
22
alter, als nur Mächtige und Mönche sich mit geschriebenen Worten verständigten. Die restlichen Men-
23
schen werden die Analphabeten des 21. Jahrhunderts sein, die hauptsächlich über Bilder und Videos
24
kommunizieren – und natürlich über Emojis.“ Mit Leichter Sprache erweist man jenen Menschen ei-
25
nen Bärendienst, die man eigentlich an die komplexe Sprachwelt heranführen und mit einem breiten
26
Wortschatz ermächtigen muss.
Anmerkung zum Autor:
Adrian Lobe (* 1988) ist Buchautor und Journalist. Aus: Lobe, Adrian (28.07.2017): Leichte Sprache: Nachrichten im Kinderbuch-Stil, letzter Zugriff am 23.07.2024. Material 6 Inklusion durch Leichte Sprache? Eine kritische Einschätzung (2015) Bettina Zurstrassen
1
[...] Durch die Bereitstellung verständlicher Texte kann in der Tat der Zugang zu gesellschaftlichen
2
und politischen Informationen niederschwelliger ermöglicht werden. Dennoch sind auch Zweifel ange-
3
bracht:
4
Sprachwissenschaftlich und soziolinguistisch muss untersucht werden, ob Leichte Sprache mit
5
ihrem eigenen Regelwerk nicht sogar die Ausgrenzung von Menschen mit Lernschwierigkei-
6
ten fördern kann, wenn diese auf den zunehmend normierten Schreib- und Sprachstil der
7
„Leichten Sprache“ hin sozialisiert werden.
8
Des Weiteren muss die Forschung prüfen, ob Leichte Sprache im Vergleich zu Einfacher
9
Sprache aufgrund ihres begrenzenden Regelwerks (z. B. die Regel, Fremdwörter zu vermei-
10
den) die Zielgruppe in ihren sprachlichen und kognitiven Entwicklungschancen nicht sogar
11
einschränkt. Aus politikdidaktischer Perspektive ist Einfache Sprache zu bevorzugen, weil
12
Fremdwörter zwar verwendet, aber erläutert werden und sie daher einen stärker aufklärenden
13
Anspruch hat. [...]
14
Die Einbindung von „Expertinnen und Experten aus der Zielgruppe“ bei der Übersetzung in
15
Leichte Sprache wird vom Netzwerk Leichte Sprache zum Gütekriterium erklärt und bei der
16
Zertifizierung eines übersetzten Textes mit einem Gütesiegel vorausgesetzt. Die Problematik
17
des „positiven Rassismus“, die hinter dieser gutgemeinten Praxis steht, wird nicht reflektiert.
18
Die Zielgruppe wird als einzig legitimer Experte ihrer Lebenswelt definiert und ihr exkludie-
19
render Sonderstatus damit verfestigt.
20
Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass im Zuge der Inklusionsdebatte eine eigene Sprache für
21
Menschen mit Lernschwierigkeiten entwickelt wird. [...]
22
Es gehört in diesem Zusammenhang zur politischen Dramaturgie von Interessengruppen, die Gruppe
23
der „Betroffenen“ möglichst weit zu definieren, um mit dem Verweis auf die gesellschaftliche Rele-
24
vanz der eigenen Forderung Nachdruck zu verleihen. [...]
25
Im [...] Ratgeber des Ministeriums für Arbeit und Soziales heißt es, dass bei der Übersetzung Teile
26
von Texten weggelassen und Beispiele eingefügt werden können, wobei die Expertinnen und Experten
27
aus der Gruppe der Menschen mit Lernschwierigkeiten entscheiden, welche Textpassagen gestrichen
28
werden können. Kriterien, die die Entscheidungsprozesse transparent machen, werden jedoch nicht
29
ausgeführt. Problematisch ist zudem, dass in den in Leichter Sprache verfassten Dokumenten oft nicht
30
deutlich gemacht wird, dass es sich bei ihnen um eine interpretative Übersetzung handelt, in die immer
31
auch normative Deutungen des/der Übersetzenden bzw. der Prüfenden einfließen. Damit birgt Leichte
32
Sprache die Gefahr der politischen Überwältigung, zumal dann, wenn die Rezipienten nicht zu einer
33
textkritisch-distanzierten Haltung sozialisiert werden. [...]
Anmerkungen zur Autorin:
Bettina Zurstrassen ist Professorin für die Didaktik der Sozialwissenschaften an der Universität Bielefeld. Aus: Zurstrassen, Bettina (26.11.2015): Inklusion durch Leichte Sprache? Eine kritische Einschätzung, letzter Zugriff am 23.07.2024. Weitere Anmerkungen:
Sprachliche Fehler wurden entsprechend der geltenden Norm korrigiert.
Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!
monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?Überschrift
- Leichte Sprache: Ein Schlüssel zur Teilhabe an der Kommunikation im öffentlichen Raum
Einleitung
- Die Teilhabe an der Kommunikation ist ein grundlegender Aspekt der demokratischen Gesellschaft. Dabei spielt die Sprache eine zentrale Rolle.
- Besonders die Leichte Sprache bietet vielen Menschen die Möglichkeit, aktiv am gesellschaftlichen Diskurs teilzunehmen.
- Doch wie effektiv ist die Leichte Sprache wirklich, um eine umfassende Teilhabe zu gewährleisten? In diesem Kommentar werden anhand der bereitgestellten Materialien die Vor- und Nachteile der Leichten Sprache diskutiert und ihre Bedeutung für die Teilhabe im öffentlichen Raum analysiert.
Hauptteil
Argumente, die für die Verwendung Leichter Sprache sprechen Förderung der Inklusion- Leichte Sprache zielt darauf ab, Sprachbarrieren zu überwinden und eine breite Zielgruppe anzusprechen. Dazu gehören Menschen mit geistigen Behinderungen, funktionale Analphabeten, ältere Menschen sowie Personen mit geringen Deutschkenntnissen.
- Laut Nicola Pridik ist Leichte Sprache ein Mittel, um „mehr Menschen zu erreichen, die auf einfache Texte angewiesen sind“ (Material 2, Z. 5-7). Diese Gruppen haben oft Schwierigkeiten, komplexe Texte zu verstehen und sind dadurch von vielen gesellschaftlichen und politischen Informationen ausgeschlossen.
- Die Verwendung Leichter Sprache hilft, diese Barrieren abzubauen und fördert die Inklusion, indem sie diesen Menschen den Zugang zu wichtigen Informationen ermöglicht.
- Die Leichte Sprache zeichnet sich durch kurze Sätze, einfache Wörter und eine klare Struktur aus. Dies macht es nicht nur für Menschen mit Verständnisschwierigkeiten leichter, Informationen aufzunehmen, sondern auch für alle, die schnelle und präzise Informationen benötigen.
- „Kurze Sätze, einfache Wörter und eine klare Struktur sind charakteristisch für Leichte Sprache“ (Material 3, Z. 14-16).
- Pridik betont, dass Leichte Sprache nicht um „schöne“ Sprache geht, sondern um verständliche und zugängliche Informationen (Material 2, Z. 25-28).
- Leichte Sprache kann als Brücke zur Standardsprache dienen. Sie ermöglicht es Menschen, die Schwierigkeiten mit komplexen Texten haben, allmählich ihre Sprachkenntnisse zu verbessern und sich dadurch langfristig besser in die Gesellschaft zu integrieren.
- „Leichte Sprache kann Menschen helfen, allmählich die Standardsprache zu erlernen“ (Material 3, Z. 23-25). Dies ist besonders wichtig für Menschen, die aufgrund von Lernbehinderungen oder Sprachstörungen dauerhaft auf einfache Texte angewiesen sind.
- Ein Nachteil der Leichten Sprache ist ihre eingeschränkte Ausdruckskraft. Da komplexe Satzstrukturen und bestimmte grammatische Formen (wie Genitiv, Passiv, Futur) vermieden werden, kann dies dazu führen, dass Informationen stark vereinfacht und Nuancen verloren gehen.
- „Komplexe Satzstrukturen und grammatische Formen werden vermieden, was zu Vereinfachungen führt“ (Material 4, Z. 17-19). Bettina M. Bock weist darauf hin, dass die Bedeutungsebene und der Kontext eine wesentliche Rolle für das Verständnis spielen und diese durch die Vereinfachung beeinträchtigt werden können (Material 4, Z. 29-33).
- Es besteht die Gefahr, dass Texte in Leichter Sprache von der breiten Öffentlichkeit als „Kindertexte“ oder minderwertige Kommunikation wahrgenommen werden.
- Letzteres kann dazu führen, dass Menschen, die auf solche Texte angewiesen sind, stigmatisiert oder ausgegrenzt werden. „Leichte Sprache könnte als minderwertige Kommunikation wahrgenommen werden“ (Material 5, Z. 10-12).
- Zudem besteht das Risiko, dass die Nutzung Leichter Sprache zu einer Segregation führt, anstatt zur Inklusion beizutragen, indem sie eine separate Kommunikationsebene schafft.
- Obwohl es für die Leichte Sprache spezifische Regeln gibt, sind diese noch relativ jung und nicht immer konsistent angewendet.
- Die Qualität und Verständlichkeit von Texten in Leichter Sprache können daher stark variieren, was ihre Effektivität einschränken kann. „Die Regeln für Leichte Sprache sind noch jung und nicht immer konsistent angewendet“ (Material 6, Z. 7-10).
Fazit
- Die Leichte Sprache bietet viele Vorteile für die Teilhabe an der Kommunikation im öffentlichen Raum. Sie fördert die Inklusion von Menschen mit Verständnisschwierigkeiten und ermöglicht ihnen, an gesellschaftlichen und politischen Diskursen teilzunehmen.
- Die einfache und klare Struktur der Leichten Sprache unterstützt zudem das Erlernen der Standardsprache und bietet eine Brücke zu komplexeren Texten.
- Gleichzeitig müssen die Einschränkungen in der Ausdruckskraft und die Gefahr der Stigmatisierung berücksichtigt werden. Es ist wichtig, dass die Leichte Sprache nicht als minderwertig wahrgenommen wird und dass die Qualität der Texte durch standardisierte Regeln sichergestellt wird.
- Insgesamt kann die Leichte Sprache einen wesentlichen Beitrag zur demokratischen Teilhabe leisten, wenn sie sorgfältig und respektvoll eingesetzt wird.
- Durch ihre Nutzung können wir eine inklusivere Gesellschaft schaffen, in der jeder Mensch die Möglichkeit hat, sich zu informieren und am öffentlichen Leben teilzunehmen.