Aufgabe 4
Materialgestützes Verfassen argumentierender Texte
Thema: Ist das Lesen von literarischen Büchern als besondere Kulturtechnik im digitalen Zeitalter noch relevant? Aufgabenstellung:- Deine Schule will sich an einer bundesweiten Lese-Offensive beteiligen, sie veranstaltet dafür eine Lesewoche, in der Erzählungen und Romane gelesen werden.
- Das Redaktionsteam der Schulzeitung bittet die Schülerschaft des Abiturjahrgangs um argumentative Beiträge zum Thema: Ist das Lesen von literarischen Büchern als besondere Kulturtechnik im digitalen Zeitalter noch relevant?
- Verfasse für die Schulzeitung einen argumentativen Beitrag, in dem du zu der strittigen Frage Stellung nimmst.
- Nutze für deine Argumentation die vorliegenden Materialien 1-8 und eigene Kenntnisse und Erfahrungen.
- Formuliere eine geeignete Überschrift.
- Dein argumentativer Beitrag sollte etwa 800-1000 Wörter umfassen.
- Verweise auf die Materialien erfolgen nur unter Angabe des Namens der Autorin oder des Autors und ggf. des Titels.

1
Erstens ist die Relevanz des Lesens (von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften) nun
2
eng mit den aufklärerischen Idealen der Bildung und der Mündigkeit verknüpft.
3
Erst als lesendes soll das Subjekt zu einem weltkundigen Subjekt werden, das
4
informiert ist, Zusammenhänge begreift, aber auch Empathie und
5
Empfindungsfähigkeit entwickelt. Die Moderne geht grundsätzlich von einer
6
„Lesbarkeit der Welt“ (Blumenberg) aus: Die Welt lässt sich in ihren
7
Zusammenhängen kognitiv begreifen, und das Lesen von nicht fiktionalen und
8
fiktionalen Texten erscheint dafür ein unabdingbarer Modus zu sein. Die Welt soll
9
im modernen Verständnis objektiviert, das heißt zu einem Gegenstand der
10
Beobachtung und Reflexion werden, und die Texte sind Instrumente dieser
11
Objektivierung. Zugleich sind diese selbst objektivierte Entitäten, zu denen man
12
im Lesen auf kritische Distanz gehen kann. Sie liefern die Voraussetzung für die
13
Ausbildung einer modernen politischen und kulturellen Öffentlichkeit, deren
14
Debatten in der Regel im Medium der Schriftlichkeit erfolgen.
15
Zweitens ist das moderne Lesen als Praxis ein extensiv-hermeneutisches und
16
ein konzentriertes Lesen. [...] Zum Modell wird nun der stille, fokussierte Leser
17
(in der Bibliothek, im Lesezimmer etc.), der keine Ablenkung zulässt und dessen
18
Aufmerksamkeit entsprechend geschult ist. Erst mit dieser
19
Aufmerksamkeitsfokussierung wird eine Immersion in den Text möglich, die im
20
mentalen Strom der Lesenden eine argumentative oder narrative ‚eigene Welt‘
21
lebendig werden lässt. Später wird man dies deep reading nennen. [...]
22
Drittens ist für das moderne Lesen zentral, dass durch das Lesen eine ‚Innenwelt‘
23
des Subjekts gefördert wird, das heißt mentale, aber auch leibliche Akte
24
intensiviert werden: Reflexion, Erinnerung, Imagination, Selbstbefragung,
25
emotionale Reaktionen. Das Lesen ermöglicht dem Subjekt damit eine
26
Psychologisierung doppelter Art: ein Training im Verständnis der psychischen
27
Welt der Anderen (die in den Büchern zum Thema wird) und der eigenen
28
‚inneren‘ Welt. Moderne Subjektideale der Selbstverantwortung und
29
Selbstentfaltung setzen entsprechend Leser voraus, die sich in der Ausbildung
30
der Innenwelt trainiert haben. [...]
31
Dies ändert sich mit der digitalen Revolution in einschneidender Weise.
32
[...] Entscheidend ist, dass die digitalen Technologien keineswegs bedeuten, dass
33
‚nicht mehr gelesen wird‘, sondern dass nun anders gelesen wird, das heißt, dass
34
sich das Lesen als Praktik und damit auch deren Subjektivierungseffekte
35
wandeln. Vereinfacht gesagt, verläuft der Wandel vom deep reading zum hyper
36
reading. Mit der digitalen Revolution, dem Computer, dem Internet und den
37
mobilen Endgeräten wie dem Smartphone wälzt sich das Mensch-Welt-Verhältnis
38
medientechnologisch tiefgreifend um. Die Merkmale der neuen Medialität sind
39
bekannt: Die digitalen Medien nehmen nach Art eines Hypermediums die alten
40
Medien der Schrift und die von Bild und Ton in sich auf. Sie alle sind
41
digitalisierbar. Im Internet werden textuelle und visuell-auditive Elemente daher
42
untrennbar miteinander verknüpft. Dies bedeutet auf der Ebene der
43
Rezeptionspraktiken jedoch: Praktiken des Lesens, des Betrachtens und des
44
Hörens sind nun nicht mehr voneinander separiert, sondern ständig miteinander
45
verwoben.
46
Kurz gesagt: Auf Facebook, Instagram oder einem Newsfeed liest man Texte und
47
Nachrichten, schaut Videos und Fotos und nebenher wird ein Computerspiel
48
gespielt. Das digitale Subjekt übt sich damit im Multitasking, wobei das Lesen
49
nur eine Aktivität unter mehreren ist. [...]
50
Die Digitalisierung verändert somit die Praxis des Lesens. Wie empirische
51
Untersuchungen zeigen, hat es bei den Digital Natives häufig nicht mehr die
52
Form des deep reading, sondern des hyper reading. Beim Lesen geht es nun
53
nicht mehr um die Immersion in einen Text, sondern um den zügigen Erwerb von
54
Informationen. Texte werden daher nicht nur äußerst schnell gelesen, sondern
55
häufig ‚quergelesen‘, das heißt auf der Suche nach Kerninformationen
56
stichprobenartig zur Kenntnis genommen. Es ist nicht nur ein kulturkritischer
57
Topos, sondern ein messbarer Tatbestand, dass die Aufmerksamkeitsspanne, in
58
der die Leser konzentriert einem Text folgen, kleiner wird. Umgekehrt wird der
59
Wunsch nach Abwechslung stärker, der Wunsch, auf immer neue und andere
60
Weise stimuliert zu werden. Das Lesen auf einem Smartphone oder Tablet, das
61
beständig andere mediale Offerten bietet, fördert diese Haltung.
62
Für die Praxis des Lesens in der digitalen Kultur ist damit eine paradoxe
63
Doppelstruktur kennzeichnend: Einerseits findet eine Ausweitung des Lesens
64
statt, das heißt eine Integration von Texten in die Alltagswelt in einem Maße, wie
65
es für die Kulturgeschichte einzigartig ist. Die ständige Verfügbarkeit der
66
Smartphones und die Social-Media-Plattformen führen dazu, dass die Subjekte
67
immer wieder kurze Lesesequenzen (und im Übrigen auch Schreibsequenzen) in
68
ihren Alltag integrieren. Während die Theoretiker der audiovisuellen
69
Medienrevolution den Niedergang des Lesens und den Siegeszug des Bildes
70
prophezeiten, erweist sich dies mit der digitalen Revolution als ein vorschnelles
71
Urteil: Gelesen wird in enormem Umfang. Auf der anderen Seite findet aber auch
72
eine Ausdünnung des Lesens statt: Das hyper reading ist ‚flacher‘ und auf
73
schnelle Information aus, die Aufmerksamkeit flüchtiger. Mediensoziologen
74
weisen daher darauf hin, dass die Genres der klassischen Moderne – die langen
75
Romane und philosophischen Traktate – gar nicht mehr zum spätmodernen
76
Lesesubjekt ‚passen‘, das sich daher auch häufig von ihnen abwendet: Sie
77
erscheinen langweilig und langatmig, unnötig kompliziert.
Andreas Reckwitz (* 1970) ist Professor für Allgemeine Soziologie und Kultursoziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Aus: Reckwitz, Andreas: Kleine Genealogie des Lesens als kulturelle Praxis. In: Katharina Raabe und Frank Wegner (Hrsg.): Warum Lesen. Mindestens 24 Gründe. Berlin 2020, S. 35-42. Material 3 Mediennutzung von Jugendlichen Medienbeschäftigung in der Freizeit 2021
– täglich/mehrmals pro Woche –
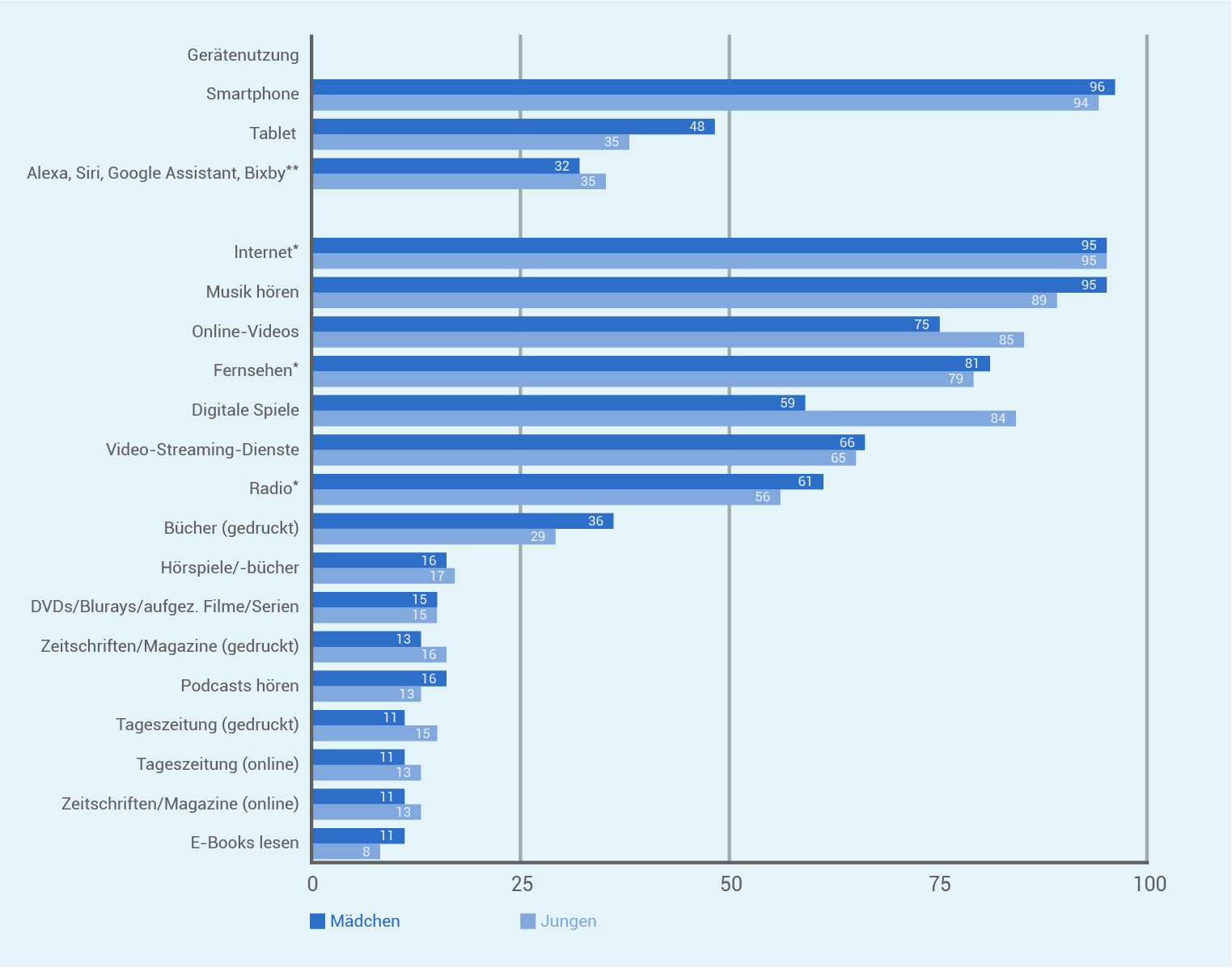
Quelle: JIM 2021, Angaben in Prozent; *egal über welchen Verbreitungsweg, **2020 nicht abgefragt, Basis: alle Befragten, n=1.200
Aus: Mediennutzung von Jugendlichen, S. 15. Material 4 Engelbarts Traum. Wie der Computer uns Lesen und Schreiben abnimmt (2014, Auszug) Henning Lobin
1
Nicht nur der Mensch, nicht nur die Schrift, nicht nur ich – das Lesen wandelt
2
sich, wie es sich immer gewandelt hat, wenn sich die Schrift, die Technologien
3
und die Medien der Schrift veränderten. Das Lesen selbst ist nicht gefährdet,
4
niemals zuvor war Geschriebenes so leicht verfügbar wie heute – jederzeit,
5
überall und für jeden. Es wird auch im digitalen Zeitalter sehr viel gelesen,
6
vielleicht mehr als je zuvor. Das Smartphone, das Tablet – all diese Geräte
7
können als universale Computer sehr viel, aber vor allem zeigen sie Schrift an,
8
ob es nun Facebook-Seiten, Spiegel Online-Meldungen oder Whatsapp-
9
Nachrichten sind. Die Kulturtechnik des Lesens floriert und hat sich sogar neue
10
Bereiche erschlossen [...]
11
Anders verhält es sich damit, wie gelesen wird. Das tägliche, überall
12
stattfindende Lesen bezieht sich nicht auf 400-seitige Bücher, sondern auf kleine
13
Texteinheiten, die in Sekunden oder wenigen Minuten aufgenommen werden.
14
Und dieses Lesen ist umgeben von anderen Formen der Kommunikation, es ist
15
nicht vertieft, konzentriert, sondern erfolgt sehr oft nebenbei, ist flüchtig und
16
dabei zugleich Teil umfassenderer Kommunikationen. Ein Roman, ein
17
philosophisches oder wissenschaftliches Werk dagegen erfordern die Versenkung,
18
eine tiefe Konzentration, ohne die ein Leser vom Entscheidenden eines Buchs
19
nicht nur etwas weniger, sondern gar nichts aufnimmt. Zwar werden auch heute
20
noch solche Werke gelesen, doch stellen sich die Verlage auf die Veränderungen
21
der Lesepraxis ein. Bücher sind in kürzere Einheiten gegliedert und Sachbücher
22
wesentlich visueller als früher. Der Hypertext hat den Leser daran gewöhnt,
23
kleinere, voneinander unabhängige Textstücke zu lesen.
Der Autor Henning Lobin (* 1964) ist Professor für Angewandte Sprachwisenschaft und Computerlinguistik. Aus: Lobin, Henning: Engelbarts Traum. Wie der Computer uns Lesen und Schreiben abnimmt. Frankfurt am Main 2014, S. 156 ff. Material 5 Erklärung von 130 Forschern: Zur Zukunft des Lesens (2019, Auszug)
1
Bildschirme und bedrucktes Papier sind als Lesemedien nicht gleichwertig: Mehr
2
als 130 Leseforscher aus ganz Europa haben eine Erklärung zur Zukunft des
3
Lesens im Zeitalter der Digitalisierung unterzeichnet.
4
[...] Die Forschung zeigt, dass Papier weiterhin das bevorzugte Lesemedium für
5
einzelne längere Texte bleiben wird, vor allem, wenn es um ein tieferes
6
Verständnis der Texte und um das Behalten geht. Außerdem ist Papier der beste
7
Träger für das Lesen langer informativer Texte. Das Lesen langer Texte ist von
8
unschätzbarem Wert für eine Reihe kognitiver Leistungen wie Konzentration,
9
Aufbau eines Wortschatzes und Gedächtnis. Daher ist es wichtig, dass wir das
10
Lesen langer Texte als eine unter mehreren Leseformen bewahren und fördern.
11
Da das Bildschirmlesen weiter zunehmen wird, müssen wir dringend
12
Möglichkeiten finden, das tiefe Lesen langer Texte in Bildschirmumgebungen zu
13
erleichtern.
Aus: Stavanger Erklärung: Erklärung von 130 Forschern. Zur Zukunft des Lesens. FAZnet., veröffentlicht am 22. Januar 2019 Material 6 Serien: Erzählen ohne Ende (2020, Auszug) Natalie Weidenfeld
1
Geschichten zu erzählen und zu hören, aus ihnen zu lernen, ist dem Menschen
2
seit Anbeginn ein soziales, ein psychologisches Bedürfnis. [...] Erzählungen sind
3
nicht nur nach wie vor hoch im Kurs, sondern, man kann fast sagen, noch
4
beliebter als je zuvor. Geschichten begegnen uns und der jungen Generation
5
zwar immer weniger in Büchern und auch immer weniger in Kinofilmen, dafür
6
umso mehr im Internet, im Streamingangebot von Amazon und Netflix.
7
Diese haben in den vergangenen Jahren eine ganz spezifische Form
8
angenommen – und zwar die der Serie. Gewiss, aufeinanderfolgende
9
Geschichten gibt es nicht erst seit Netflix: Romane in Fortsetzungsform waren
10
schon im 19. Jahrhundert ein Kassenschlager. Aber dass Serien die Massenkultur
11
derart dominieren, ist nun doch ein spezifisches Phänomen des 21. Jahrhunderts.
12
Seriöse Regisseure, seriöse Schauspieler – sie alle setzen auf Serien. Und das
13
aus dem einfachen Grund, dass dort das meiste Geld und der meiste Erfolg
14
liegen. Postmoderne Kritiker können jubeln.
15
Endlich eine Ästhetik, welche die geschlossene, vermeintlich bürgerliche
16
geschlossene Erzählform – die den marxistischen Kritikern schon immer ein Dorn
17
im Auge war – sprengt und dafür eine neue, multiperspektivische,
18
superdemokratische kreiert. Ganze Horden von Universitätsdozenten stürzen sich
19
nun auf die intellektuelle Aufarbeitung populärer Serien – was nicht nur volle
20
Seminarsäle garantiert, sondern auch noch den Spaßfaktor erhöht.
21
Dabei erreicht die Begeisterung für die Serie und das serielle Erzählen ein Level,
22
dass Filmwissenschaftler wie Georg Seeßlen und Markus Metz in ihr den Ausdruck
23
einer neuen fatalistischen Metaphysik erkennen: Wie die Helden in einer Serie oft
24
immer auch gut und böse zugleich sind, sind auch wir gleichzeitig gut und böse,
25
und so wie die Geschehnisse in der Serie nicht so bleiben, wie sie sind, bleibt
26
auch die Welt nie so, wie sie ist. Endlich eine Erzählform, die das wahrhaft
27
Menschliche wirklich abbildet!
Natalie Weidenfeld (*1970) ist promovierte Kulturwissenschaftlerin und Buchautorin. Aus: Weidenfeld, Natalie: Serien. Erzählen ohne Ende. Material 7 Immaterielle Realitäten (2020, Auszug) Wolf Singer
1
Ein [...] durch mehrere Studien abgesicherter Befund ist die Verkürzung der
2
Aufmerksamkeitsspanne bei Kindern, die viel Zeit vor dem Bildschirm verbringen.
3
Der Grund ist vermutlich, dass Inhalte in linearer Form aneinandergereiht
4
werden müssen, der Rhythmus vorgegeben wird und die raschen
5
Schnittsequenzen keine Anforderungen an die Integration zeitlich weit
6
auseinanderliegender Ereignisse erfordern. Lesen, insbesondere von
7
anspruchsvollen Texten, erfordert hingegen, eine Brücke zu schlagen vom
8
Anfang eines Satzes, hinweg über mehrfach verschachtelte Nebensätze bis zum
9
befreienden Verb am Satzende. Denn erst dieses erlaubt eine Festlegung der
10
Bedeutung aller vorangegangenen Satzelemente. Hier sind Arbeitsgedächtnis und
11
lange Aufmerksamkeitsspannen gefragt. Offenbar entwickeln sich beide
12
Funktionen nur eingeschränkt oder verkümmern sogar, wenn sie nicht gefordert
13
werden. Das Lesen von anspruchsvollen Texten scheint hier ein wirksames
14
Antidot zu sein. [...]
15
[D]as Lesen [nimmt] eine Sonderstellung ein, die es von allen anderen
16
Rezeptionsformen unterscheidet. Es räumt dem Rezipienten ein Höchstmaß an
17
Freiheit ein, fordert ihn aber zugleich, ganz besonders viel vom Eigenen
18
einzubringen, das Gelesene mit Vorstellungen, Erinnerungen, Gedanken und
19
Bildern kreativ zu ergänzen. Wer im Kino sitzt oder vor der Mattscheibe oder in
20
seinem Smartphone YouTube schaut, dem wird fast jegliche Eigenleistung
21
abgenommen: Der Regisseur und Kameramann legen fest, worauf die
22
Aufmerksamkeit gelenkt werden soll, Prosodie und begleitende Filmmusik sorgen
23
für die emotionale Einbettung des Geschehens, und die Bilder betäuben die
24
Phantasie, weil sie nicht gebraucht wird, um sich die Ereignisse vorzustellen. Der
25
Zuschauer wird mit fast allen Sinnen vereinnahmt und gezwungen, in Echtzeit
26
den Vorgaben des Mediums zu folgen. Und damit er sich nicht entziehen und
27
eigenen Assoziationen nachgehen kann, werden die Schnittsequenzen erhöht.
28
Das nimmt dem Zuschauer die letzte Möglichkeit, dem Gesehenen mit Abstand
29
und selbstgewählter Perspektive zu begegnen. [...]
30
Auch wenn die Verschriftlichung an Grenzen des Vermittelbaren stößt, die nur
31
durch Einbeziehung anderer Sinne – und das auch nur zum Teil – überwunden
32
werden können, sollte schon allein die Freiheit, die nur Lesen einräumt, als hohes
33
Gut gewertet werden. Denn sie ist es, die Pluralität begünstigt. Weil jeder Leser
34
über seinen eigenen Schatz an Vorwissen verfügt und dieser, wie ausgeführt,
35
festlegt, wie das Gelesene wahrgenommen wird, verwandelt sich jeder den Text
36
auf verschiedene, sehr idiosynkratische Weise an. Das gilt auch für die
37
Rezeption von Gesprochenem und von Filmen, wenn auch in weit geringerem
38
Maße, weil sie, wie dargelegt, der Phantasie weniger Raum geben.
39
Nun wird oft angeführt, Lesen sei anstrengend. Ja, das ist es, weil kreative
40
Prozesse das Gehirn fordern. Aber die Mühe lohnt.
Wolf Singer (* 1943) ist Neurophysiologe und Hirnforscher. Aus: Singer, Wolf: Immaterielle Realitäten. In: Katharina Raabe und Frank Wegner (Hrsg.): Warum Lesen. Mindestens 24 Gründe. Berlin 2020, S. 157-160. Material 8 Mythos Kinderbuch – Warum Jim Knopf aus mir keinen besseren Menschen gemacht hat. (2015, Auszug aus einer Rede) Andreas Steinhöfel
1
Mein verstorbener Lebensgefährte war ein ADHS-Erwachsener. Er stand Vorbild
2
für die Hauptfigur in meinem Kinderbuch Rico, Oskar und die Tieferschatten, und
3
er las das Buch in unserem letzten gemeinsamen Urlaub. Für die Lektüre der
4
etwa 200 großzügig gesetzten Textseiten benötigte er sieben Tage zu jeweils
5
etwa zwei Stunden ... das sind, ich hab’s für Sie ausgerechnet, damit Sie mir hier
6
nicht schon zu Beginn dieser Sause heimlich wegkippen, pro Seite etwa vier
7
Minuten Lesezeit. Schwitzend las er und fluchend und, ja, auch lachend, und
8
glücklich zuletzt und stolz... aber ich hatte meinen Freund zu weniger Kraft
9
raubenden Gelegenheiten glücklicher erlebt und stolzer erlebt. Er hatte das Buch
10
nur mir zuliebe gelesen und, na gut, sicherlich auch ein wenig aus Eitelkeit ...
11
Pro Seite vier Minuten jedenfalls, in denen mein Freund angestrengt las, und
12
bitte, stellen Sie sich das nicht lustig vor: einen Menschen, dem von der schieren
13
Anstrengung des Lesens der Schweiß ausbricht. Stellen Sie sich stattdessen,
14
liebe Anwesende, irgendein Wissensgebiet oder Tätigkeitsfeld vor, das Sie gar
15
nicht oder nur rudimentär beherrschen und dem Sie deshalb nur mit großer
16
innerer Ablehnung begegnen – in der Regel reicht dazu Mathe oder die
17
europäische Bankenpolitik – und versuchen Sie dann, sich eine Woche lang, drei
18
Stunden täglich damit konfrontiert zu sehen – Spaß geht anders!
19
Mein jüngster Bruder las bisher Zeit seines Lebens genau drei Dinge: Als Kind –
20
immer auf einem Stuhl gegen die Heizung sitzend, in Unterwäsche, die nackten
21
Füße auf dem Heizkörper, auf dem Tisch ein Glas Kakao – jeden einzelnen Band
22
um den Gallier Asterix sowie alle Comics der Reihe Lustiges Taschenbuch von
23
Disney. Inzwischen, als Erwachsener, liest er hin und wieder, zu seinem
24
Amüsement, wie er sagt, die BILD-Zeitung. Er ist Elektriker. Kein Studium. Keine
25
Literatur, auch kein von mir verfasstes Buch, das er je gelesen hätte. Zu
26
anstrengend, sagt er. Und redet Sie dennoch, das garantiere ich, gegen fast jede
27
vorstellbare Wand, mit der Eloquenz eines hoch dotierten Staatanwalts und
28
einem universellen Wissen, von dem ich bis heute nicht weiß, woher mein Bruder
29
es bezieht, jedenfalls nicht aus Büchern. [...]
30
Zwei Nichtleser-Biographien. Zwei Kinder, die sehr wohl die Kulturtechnik des
31
Lesens beherrschten, sich aber von nichts und niemandem dazu bringen ließen,
32
mal das berüchtigte gute Buch zu lesen. Oder überhaupt irgendein Buch. Oder
33
wenigstens mal einen Arzneimittelbeipackzettel. Beide Männer aber, lassen Sie
34
sich das versichert sein, liebe Anwesende, beide Männer waren bzw. sind
35
wunderbare Menschen. Warmherzige, einfühlsame und mitfühlende, hilfsbereite
36
und patente, loyale Menschen. Die sie auszeichnenden Qualitäten waren nicht
37
durch Lektüre oder gar Studium erworben, sondern in einem alltäglichen
38
Miteinander, das auf einfachen Regeln basiert, zum Beispiel der, dass man
39
leichter durchs Leben kommt, wenn man einander unterstützt, als sich
40
gegenseitig auf die Köpfe zu hauen. Oder der, dass man anderen nur zumuten
41
sollte, was man selber zu ertragen bereit wäre. Sie wissen schon: Goldene
42
Regeln.
43
Haben Sie schon mal überlegt, wie viel Zeit Sie mit schlechten Büchern
44
verplempert haben? Nicht-Leser haben dieses Problem nicht. Die tun in jener
45
Zeit, die unsereins mit Lesen verbringt, etwas anderes, nämlich das, worüber wir
46
so gern lesen: Sie leben.
Andreas Steinhöfel (*1962) ist ein bekannter Jugendbuchautor, u.a. schrieb er den Jugendroman Die Mitte der Welt und die Bände um das ungleiche Freundespaar Rico und Oskar, die auch verfilmt worden sind (z.B. Rico, Oskar und die Tieferschatten). Aus: Steinhöfel, Andreas: Mythos Kinderbuch – Warum Jim Knopf aus mir keinen besseren Menschen gemacht hat (Auszug aus einer Rede, gehalten am 22.2.2015 in Dresden)
Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!
monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?Überschrift
Eine Betrachtung der Relevanz literarischer Bücher als Kulturtechnik in unserer heutigen digitalen WeltEinleitung
- Im Zeitalter von Smartphones, Tablets und Co. gerät die klassische Kultur des Lesens auf Papier häufig in den Hintergrund. Vorteile des digitalen Lesens wie Bequemlichkeit und Mobilität werden von immer mehr Menschen geschätzt. Im Gegenzug wird vergessen, welch wertvolle kulturelle Bedeutung und unverzichtbaren Einfluss von literarischen Büchern ausgeht.
- Wir alle nehmen tagtäglich wahr, dass die Tätigkeit und Kultur des Lesens in der heutigen Zeit einige Veränderungen erfährt. Deshalb stellt sich zu Recht die Frage, ob das Lesen von literarischen Büchern als besondere Kulturtechnik im digitalen Zeitalter überhaupt noch relevant ist. Zur Beantwortung dieser durchaus komplexen Frage sollen sowohl Argumente für als auch gegen die Relevanz literarischer Bücher angeführt werden.
Hauptteil
Argumente, die für die Relevanz literarischer Bücher als besondere Kulturtechnik im digitalen Zeitalter sprechen- Für die weiterhin bestehende Relevanz literarischer Werke spricht, dass Literatur sowohl in der Geschichte als auch heute noch als Quelle für Bildung angesehen wird (M2, M5). Sie hilft uns dabei, tiefgreifendes Wissen anzueignen, unsere Welt zu verstehen und zu begreifen, an Informationen zu gelangen und Sinnzusammenhänge herzustellen (M2). Literatur fördert somit unsere persönliche und intellektuelle Entwicklung sowie unsere kognitiven Fähigkeiten (M2, M5, M8).
- Ebenfalls sorgen literarische Werke dafür, dass unsere Empathie- und Reflexionsfähigkeit sowie unsere Vorstellungskraft und Kreativität gefördert werden (M2, M7). Leser*innen haben die volle Freiheit in der Interpretation des Gelesenen, was wiederum „die Pluralität [der Interpretationen] begünstigt“ (M7, Z. 33). Die Auseinandersetzung mit Charakteren aus Büchern sorgt für einen wichtigen Perspektivenwechsel in der realen Welt statt oberflächlicher Kommunikation in der rein digitalen Welt.
- Das Lesen in Büchern hilft außerdem dabei, sich konzentrierter mit Inhalten zu beschäftigen und seine Aufmerksamkeit zu erhöhen, da eine Ablenkung durch z. B. Benachrichtigungen auf Messenger-Diensten an dieser Stelle ausgeschlossen werden kann (M2, M5, M7). Dies sorgt wiederum dafür, dass Leser*innen die gelesenen Inhalte auch wirklich verstehen und sich reflektiert und kritisch mit den Inhalten auseinandersetzen können (M2, M4, M5, M7). Bei digitalen Medien kommt diese Art von „deep reeding“ (M2, Z. 21) zu kurz. Durch die Verknüpfung der textuellen und visuell-auditiven Ebene kann es bei den Menschen schnell zu einer Überforderung kommen (M2). Außerdem wird die Aufmerksamkeitsspanne der Leser*innen aufgrund des enormen Umfangs an Inhalten deutlich kürzer (M7). Multimediale Elemente wie Videos und Bilder haben zur Folge, dass unsere Vorstellungskraft weniger beansprucht wird und kreative Prozesse im Gehirn eingeschränkt werden (M8). Man fokussiert sich auf oberflächliche, schnell verfügbare Informationen (M2). Bisher gibt es noch keine langfristigen Lösungen, wie man den Leser*innen das tiefe und konzentrierte Lesen von langen Texten auf Bildschirmen erleichtern kann (M5).
- Im heutigen Zeitalter der Digitalisierung dominieren die Schnelllebigkeit und ständige Informationsflut häufig unseren Alltag. Modernes Lesen kann hingegen entschleunigend auf uns wirken und ist auch digital entlastend. Leser*innen wird durch klassische Literatur die Möglichkeit gegeben, in die introspektive Welt der Literatur zu fliehen und sich sowohl geistig als auch emotional voll und ganz auf eine Geschichte einzulassen (M2).
- Literatur gilt als fester und wichtiger Bestandteil unserer Kultur und trägt auch zur kulturellen Kommunikation in unserer „modernen politischen und kulturellen Öffentlichkeit“ (M2, Z. 13) bei. Klassische Werke spiegeln bspw. die zeitgenössische Gesellschaft und Lebensweise der damaligen Zeit wider, bieten uns heute noch einen guten Einblick in die Geschichte und erweitern unseren intellektuellen Horizont.
- Digitale Literatur (z. B. in Form von Online-Texten und E-Books) ist im Gegensatz zur klassischen Buchkultur deutlich umfangreicher, ständig verfügbar und kann damit auch ort- und zeitunabhängig genutzt werden (M2, M4). Es kommt zu einer „Ausweitung des Lesens“ (M2, Z. 6). Das hat zur Folge, dass wir Menschen heutzutage sogar weitaus mehr lesen, da die Digitalisierung uns das Lesen so einfach macht wie noch nie zuvor (M4). Ein weiterer Grund dafür ist auch, dass digitales Lesen einen schnelleren Informationserwerb ermöglicht (M2).
- Weiterhin ist es für Schüler*innen praktisch, wenn die Lektüre nicht ständig im Rucksack mitgeführt werden muss. Mithilfe eines E-Books hat man auf einem einzigen Gerät Zugang zu Tausenden von Büchern. Außerdem passen viele literarische Werke nicht mehr in unsere heutige Zeit, sind schwer verständlich oder wirken sogar inhaltlich abschreckend. Digitale Medien ermöglichen hingegen bereits während des Lesens einen Zugang zu weiterführenden Erklärungen, hilfreichen Wörterbuchdefinitionen oder Erklärvideos. Funktionen und Anpassungsoptionen digitaler Plattformen wie die Änderung der Schriftgröße, die Regulierung der Helligkeit, Notizen und farbliche Hervorhebungen sorgen für ein angenehmes und personalisiertes Leseerlebnis und erleichtern zusätzlich das Verständnis der Lektüre. Dieser enorme Vorteil, dass die Leser*innen ihre Leseerfahrung auf digitalen Medien an ihre individuellen Bedürfnisse und Präferenzen anpassen können, kommt bspw. auch Menschen mit Sehschwierigkeiten oder unterschiedlichen Lerntypen zugute. Für auditive Lerntypen stellen z. B. Hörbücher eine große Bereicherung dar (M1).
- Geschichten sind heutzutage weniger in Büchern, sondern vermehrt im Internet und in den klassischen Streamingangeboten wie Netflix oder Amazon präsent (M3, M6). Die klassische „geschlossene Erzählform“ (M6, Z. 16) ist in den letzten Jahren deutlich in den Hintergrund gerückt und eine neue Form von Serienkultur mit ihrer „multiperspektivische[n]“ (M6, Z. 17) und „demokratische[n]“ (M6, Z. 18) Erzählweise hat sich etabliert (M6). Dahinter verbirgt sich eine ganz neue Sicht auf die komplexen und ambivalenten Charaktere einer Serie, die in einer Welt leben, die sich ebenfalls ständig verändert (M6). Somit passt diese Erzählweise weitaus besser zu unserer heutigen, sich ebenfalls kontinuierlich verändernden Welt (M6). Literatur in digitaler Form hat somit die Möglichkeit, sich weitaus schneller an aktuelle Gegebenheiten und Veränderungen anzupassen und mit der Zeit zu gehen.
- Insbesondere für die jüngeren Generationen ist die Nutzung digitaler Medien, z. B. des Smartphones und Tablets weit verbreitet (M3). Bereits im frühen Alter ist das Lesen auf digitalen Medien zur Normalität geworden und ist weitaus praktischer als das klassische Lesen (M1, M3). Mithilfe des Internets kommen wir von überall aus an Informationen. Wie wichtig das Smartphone oder der Laptop auch für die Kommunikation und soziale Interaktion im schulischen und privaten Raum ist, hat uns die Corona-Pandemie deutlich gezeigt.
- Heutzutage lassen sich deutliche Veränderungen der Lesegewohnheiten und Lesepräferenzen feststellen. Die Menschen favorisieren kürzere Texte in digitaler Form, die mit wenig Anstrengung und kognitivem Aufwand verbunden sind, statt langen Büchern (M1, M3, M7, M8). In unserer heutigen, hektischen Welt haben wir oft das Gefühl, keine Zeit mehr zum Lesen zu finden. Für viele Menschen stellt das klassische Lesen deshalb eine Herausforderung dar (M8). Das digitale Lesen ermöglicht es uns innerhalb kürzester Zeit, an die wichtigsten Informationen zu gelangen (M2, M7, M8).
- Vielen Menschen wird immer klarer, dass das Lesen von Büchern keine zwingende Voraussetzung darstellt, um ein guter, warmherziger und intelligenter Mensch zu sein (M8). Auch durch alltägliche Erfahrungen z. B. im zwischenmenschlichen Miteinander und Kommunizieren kann man „Qualitäten“ (M8, Z. 36) wie Empathie und Hilfsbereitschaft erlernen (M8).
- Zuletzt sollte man festhalten, dass digitale Medien eine umweltfreundlichere und meist auch kostengünstigere Alternative zu herkömmlichen gedruckten Büchern darstellen. Insbesondere im Kontext von Schule und Unterricht fällt immer wieder auf, welche enormen Mengen an Papier zum Lesen und Lernen verwendet und nur nach kurzer Zeit schon wieder entsorgt werden.
Schluss
- Es wird deutlich, dass die klassische Lesekultur weiterhin einen relevanten Platz in unserer Gesellschaft hat, u. a. unsere Konzentration, Reflexionsfähigkeit und Kreativität fördert sowie uns dabei hilft, unseren Alltag zu entschleunigen. Auch die kulturelle Verbundenheit mit der Literatur ist nicht zu verneinen.
- Auffällig ist, dass die Praxis des Lesens erhalten bleibt und nur die Art und Weise sich verändert bzw. an unsere heutigen Gegebenheiten und Möglichkeiten angepasst hat (M4). Damit ist das digitale Lesen auch nicht ausschließlich als Gegensatz zur klassischen Lesekultur zu sehen, sondern vielmehr als eine hilfreiche Ergänzung im Alltag eines jeden. Online-Plattformen bieten uns eine enorme Vielfalt an Literatur und ermöglichen uns, das Lesen einfach in unseren Alltag zu integrieren.
- Insgesamt lässt sich jedoch festhalten, dass die Praxis des Lesens stark von den individuellen Präferenzen abhängig ist. Wir Menschen haben unterschiedliche Einstellungen zum Lesen abhängig von Faktoren wie Alter, Erziehung, Gewohnheiten und Lebensweise. Doch wie mit allen Dingen ist es auch an dieser Stelle von Vorteil, die Vorzüge des digitalen Lesens auszutesten und mit der Zeit zu gehen.